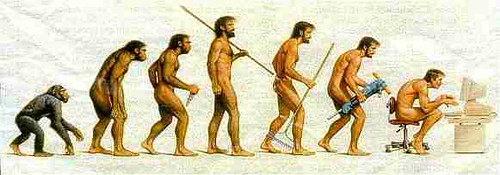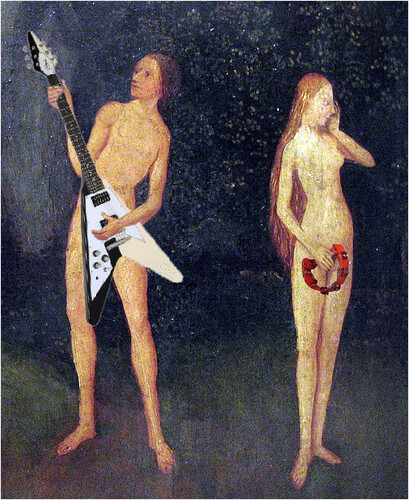Den folgenden Text habe ich für den Lorenzer Kommentargottesdienst gestern geschrieben. Das Thema hat mich ja verschiedentlich hier schon beschäftigt, dies ist die momentane Quintessenz meiner Überlegungen. Die Diskussion verlief erwartungsgemäß kontrovers.
„Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Dieser Satz könnte sich in diesen Tagen wieder einmal bewahrheiten – nicht überall auf der Welt, aber in den meisten westlichen Ländern. Familie, das wissen wir alle schon länger (auch wenn die Bewertungen dieses Sachverhalts unterschiedlich ausfallen), ist im 21. Jahrhundert nicht mehr nur das klassische Vater-Mutter-1,2 Kinder-Arrangement. Ein ähnlicher Wandel bahnt sich nun im Verständnis der Ehe an:
Am 22. Mai dieses Jahres sprachen sich fast zwei Drittel der überwiegend katholischen Iren per Volksentscheid für die Einführung der „Ehe für Alle“ aus. Am 26. Juni entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass gleichgeschlechtlichen Paaren nirgendwo im Land die Eheschließung verwehrt werden darf. Richter Anthony Kennedy – ein Konservativer aus einer irisch-katholischen Familie – begründete das Urteil so:
Kein Bund ist tiefgründiger als die Ehe. Er vereint in sich die höchsten Ideale der Liebe, Treue, Hingabe, Aufopferung und Familie. Indem sie die Ehe eingehen, werden zwei Menschen zu etwas Größerem als zuvor. Wie manche Kläger uns zeigen, verkörpert die Ehe eine Liebe, die so groß ist, dass sie sogar den Tod überdauert. Anzunehmen, dass diese Männer und Frauen die Idee der Ehe nicht respektieren, würde ihnen nicht gerecht. Sie respektieren sie, sie respektieren sie so sehr, dass sie diese Erfüllung für sich selbst wünschen. Ihre Hoffnung ist, dass sie nicht dazu verdammt sind, in Einsamkeit zu leben, ausgeschlossen von einer der ältesten Institutionen der Zivilisation. Sie erbitten sich die gleiche Würde vor dem Gesetz. Die Verfassung garantiert ihnen dieses Recht.
In Deutschland scheitert eine vergleichbare Regelung bekanntlich noch am Bauchgefühl von Kanzlerin Angela Merkel. Aber die große Resonanz auf die Entscheidungen in Irland und den USA lässt ahnen, dass sich die „Ehe für alle“ auch bei uns bald durchsetzt. Hier wie dort gibt es freilich beachtliche Minderheiten, bei denen diese Neudefinition schwere Bauchschmerzen verursacht. Unter ihnen sind auch viele sehr religiöse Menschen. Zugleich fällt auf, dass die Differenzen nicht nur durch unterschiedliche soziale Milieus bedingt sind, sondern auch mit dem Alter zu tun haben. Viele meiner konservativen Bekannten räumen im persönlichen Gespräch ein, dass ihre Kinder völlig anders denken als sie selbst.
Aber es wäre zu einfach, diese Diskussion auf simple Gegensätze wir konservativ und progressiv, evangelikal und liberal, bibeltreu und zeitgeistaffin oder jung und alt zu reduzieren. Viele von uns sind groß geworden mit einem mal mehr, mal weniger modernisierten Bild der christlichen Familie, in der die „Ehe von Mann und Frau als gute Gabe Gottes“ gilt (so sagt es die lutherische Trauagende) und Kinder als der sichtbare Segen des Ehestandes (so haben wir es gesungen). Solche Texte sind die kulturelle Brille, durch die wir die Schrift lesen und auslegen.
Seit die Aufklärung den – wie sie fand: potenziell intoleranten – Glauben sanft in die Privatsphäre abgedrängt hatte, seit jeder preußische Untertan nach seiner Façon selig zu werden hatte (aber bitte ohne sich in die Politik einzumischen), entdeckte die Kirche die Förderung und Besserung der Familie als Aufgabenfeld. Gefallene Mädchen, unverheiratete Töchter, Witwen und Waisen sowieso, trinkende Väter oder Mütter, deren Genesung Not tut. In Ermangelung anderer Gottesbeweise füllte die glückliche – oder zumindest anständige und um Besserung bemühte – Familie diese Lücke. Die Kirchen waren bei Trauung, Geburt und Taufe präsent und betrachteten diese Art der Familienpflege als Kernkompetenz. Singles und Geschiedene hielt die kerngemeindliche Familienseligkeit mancherorts auf Distanz. Und im evangelischen Pfarrhaus als Mittelpunkt der Gemeinde wurde das christlich-bürgerliche Familienideal modellhaft vorgelebt.
Eher vereinzelt und leise erinnerten evangelische Theologen daran, dass Jesus und Paulus unverheiratet waren und die höchste Bestimmung des Menschen nicht in der Rolle als Eltern und Ehepartner sahen, sondern im Trachten nach dem Reich Gottes. Immer wieder wurde hingegen das Gegenüber von Mann und Frau aus der Schöpfungsgeschichte auf Gott projiziert. Das eigentliche Ebenbild Gottes ist aus dieser Perspektive nicht der einzelne Mensch oder die Menschheit insgesamt, sondern Mann und Frau, das heterosexuelle Ehepaar, die einander in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen, lieben und ergänzen. Diese Konstruktion des Geschlechterverhältnisses war insofern sympathisch, als sie die traditionelle Unterordnung der Frau unter den Mann aufweichte. Der Preis war eine theologische Überhöhung dieser geschlechtlichen Polarität zu einer absoluten, Gott- und naturgegebenen „Schöpfungsordnung“, die als das Fundament von Kirche und Gesellschaft unbedingt zu verteidigen ist.
In fast jedem öffentlichen Gebäude erinnern uns die Toiletten daran, dass Menschen – zumindest für Architekten und Bürokraten – entweder als Frauen oder als Männer existieren. Was – und vor allem wer – sich nicht in dieses binäre Entweder/Oder fügt, gilt unwillkürlich als schräg, stur oder neurotisch. Legt man aber diese kulturbedingte „heteronormative“ Brille ab, ergibt sich ein komplexeres Bild: „Männlich“ und „weiblich“ sind keine transzendentalen Kategorien und keineswegs immer exklusiv auf einander bezogen: Ein „Mann“ ist nicht dadurch definiert, dass ihm alles vermeintlich Weibliche fehlt (und umgekehrt), und das Begehren richtet sich ebenfalls nicht ausschließlich auf das „ganz andere“. Versuche, geschlechtliche Uneindeutigkeiten zu ignorieren oder sie durch medizinische Eingriffe verschwinden zu lassen, haben immenses Leid verursacht. Wenn also „normal“ nicht nur einen statistischen Durchschnitt, sondern einen anzustrebenden Zustand bezeichnet, dann muss die Norm hier neu definiert werden. Das ist anstrengend und schmerzhaft.
Normen und Bauchgefühle – der gesellschaftliche Kontext dieser Diskussion ist der Bedeutungsverlust der oft sehr kirchlich gesinnten „bürgerlichen Mitte“ in Deutschland. Der Jesuit Eckhart Bieger schreibt dazu treffend:
„Die Bürgerliche Mitte entwickelt eine eigene Mentalität, einfach deshalb, weil alle anderen Lebenswelten in einem Abstand zur Mitte leben. Deshalb fühlen sich die Bewohner der Mitte als die Normalbürger. Sie müssen nicht darüber nachdenken, sondern sie erleben alle an anderen Milieus als abweichend von der Mitte […] Sie erwarten, dass andere sich ihnen anpassen.“
Nun könnte man die Bemühungen um die Ehe für alle ja durchaus so verstehen, dass hier Ideale der bürgerlichen Mitte in andere Milieus ausstrahlen. Aber diesem droht der Verlust eines identitätsstiftenden Alleinstellungsmerkmals, wenn das Andere „normal“ sein darf. Dieser „Werteverfall“ wird als Kränkung und Herabsetzung erlebt: Die „Ehe für alle“ relativiert das bisherige Eheideal, und diese Relativierung ist eine gefühlte Beschädigung – auch der eigenen Person und Lebensgeschichte.
Im Gegensatz zum bürgerlich-neuzeitlichen Eheideal sind die biblischen Aussagen zur Ehe erstaunlich vielschichtig und unsystematisch. Die Vielehe etwa tritt stillschweigend zurück, wird aber nirgends ausdrücklich für abgeschafft erklärt. Eine Definition im engeren Sinn fehlt.
Dass der Versuch, die unterschiedlichen Positionen zur Ehe für alle auf den Konflikt zwischen Bibeltreuen und Bibelverächtern zu reduzieren, nicht aufgeht, lässt sich an eben jenen Texten aus der biblischen Urgeschichte zeigen, die immer wieder zur Begründung einer nicht verhandelbaren „Schöpfungsordnung“ herangezogen wurden.
Wir haben in Genesis 1 und 2 zwei unterschiedliche Erzählungen. Dass sie hintereinander stehen, hat zu dem Fehlschluss Anlass gegeben, die zweite Geschichte baue auf die erste auf und erzähle sie weiter, und in Folge dessen hat man (ähnlich wie das klassische Krippenspiel es mit den Geburtsgeschichten von Matthäus und Lukas macht) die einzelnen Aussagen munter vermischt.
In Genesis 1 lesen wir von der Gattung Mensch und nicht von einzelnen Exemplaren:
Gott sprach: Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis! Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all, und alles Gerege, das auf Erden sich regt.
Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich, weiblich schuf er sie.
Gott segnete sie, Gott sprach zu ihnen: Fruchtet und mehrt euch und füllet die Erde und bemächtigt euch ihrer! Schaltet über das Fischvolk des Meers, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt!
Es ist hier mit keinem Wort gesagt, dass es im Anfang nur zwei Menschen gab, so wie es auch von den Tieren nicht vorausgesetzt ist, dass im Urzustand (ähnlich wie auf der Arche Noah) nur je ein Paar vorhanden war. Hätten wir die zweite Geschichte nicht immer schon im Ohr und im Hinterkopf, wären wir aufgrund dieses Textes vermutlich nie auf eine solche Idee gekommen. Die Menschen sollen sich vermehren, ebenso wie die Erde ihrerseits Tiere und Pflanzen hervorbringt. Über das, was wir unter Ehe verstehen, ist damit noch gar nichts ausgesagt, sogar die Substantive „Mann“ und „Frau“ fehlen.
Umgekehrt fehlt der Gedanke der Fortpflanzung nun in der zweiten Schöpfungserzählung. Hier deuten sich leise Elemente eines biblischen Eheverständnisses an, wenn am Ende einer langen Reihe inkompatibler Lebewesen die „Männin“ – so übersetzte Martin Luther – erscheint. Zunächst aber ist der Mann ganz allein im Garten:
ER, Gott, sprach: Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm Gegenpart.
ER, Gott, bildete aus dem Acker alles Lebendige des Feldes und allen Vogel des Himmels und brachte sie zum Menschen […] Aber für einen Menschen erfand sich keine Hilfe, ihm Gegenpart.
ER senkte auf den Menschen Betäubung, dass er entschlief, und nahm von seinen Rippen eine und schloss Fleisch an ihre Stelle. ER, Gott, baute die Rippe, die er vom Menschen nahm, zu einem Weibe und brachte es zum Menschen.
Der Mensch sprach: Diesmal ist sie’s! Bein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch! Die sei gerufen Ischa, Weib, denn von Isch, vom Mann, ist die genommen. Darum lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und haftet seinem Weibe an, und sie werden zu Einem Fleisch. (2,18-24)
Nun kann man den Hinweis auf die Intimität zwischen Mann und Frau zwar so lesen, dass Kinder die natürliche Folge davon sind. Dennoch zeigt sich deutlich, dass die Fortpflanzung nicht der Stiftungsgrund für das Verhältnis von Mann und Frau ist, sondern das beherrschende Thema dieser Zeilen ist die Partnerschaft und das Gegenüber beider, den Kontrast bildet die Einsamkeit. Der Geschlechterunterschied tritt hier auffällig zurück hinter die Betonung der Ebenbürtigkeit und Ähnlichkeit von Mann und Frau. Kinder können dazugehören, müssen aber nicht.
Ehe lässt sich also ohne Bruch mit der biblischen Überlieferung, wenn auch nicht ohne die Brillen manch kirchlicher Tradition abzusetzen, inklusiv verstehen. Nicht die korrekte Geschlechterverteilung macht sie aus, sondern Ebenbürtigkeit, Zuneigung, Treue und Fürsorge. Wer sich danach sehnt und darauf einlässt, sollte auch in den Kirchen nicht am zeremoniellen Katzentisch abgespeist werden.
Dann können wir auch in Ruhe die politischen Entscheidungen abwarten. Letzte Woche schrieb die 13-jährige Lily an die Kanzlerin, sie solle der „Ehe für alle“ zustimmen. Heiraten zu dürfen gehöre zu den Grundbedürfnissen wie Nahrung und Wasser. „Jeder“, so schreibt sie, „verdient eine Chance auf ein gleichermaßen glückliches Leben. Finden Sie nicht auch?“