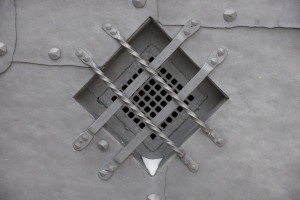 Am vergangenen Wochenende hat Paul Zulehner die Universalität der biblischen Heilszusagen angeschnitten. Es geht Gott um nichts weniger als die Erlösung der Menschheit, und nicht einer kleinen Schar von Erwählten (während der Rest als massa damnata in der Hölle brutzelt). Seit Augustinus († 430) ist ersteres die Mehrheitsposition der westlichen Christenheit gewesen, mittlerweile ist aber einiges in Bewegung geraten.
Am vergangenen Wochenende hat Paul Zulehner die Universalität der biblischen Heilszusagen angeschnitten. Es geht Gott um nichts weniger als die Erlösung der Menschheit, und nicht einer kleinen Schar von Erwählten (während der Rest als massa damnata in der Hölle brutzelt). Seit Augustinus († 430) ist ersteres die Mehrheitsposition der westlichen Christenheit gewesen, mittlerweile ist aber einiges in Bewegung geraten.
Es lohnt sich, bei dem Thema zu verweilen: Der theologische Exklusivismus funktioniert nach der Formel „Wir kommen in den Himmel, die anderen nicht“. So schroff wird das selten formuliert, aber die Position wird ja doch in der Regel von denen vertreten, die relativ sicher wirken, dass sie der richtigen Religion (und natürlich Konfession) angehören und damit qualifiziert sind für die Zukunft in der lichtdurchfluteten Hälfte des durch einen breiten Graben geteilten Jenseits.
Dass diese Heilsgewissheit entgegen aller Beteuerungen immer auch mit irgendeiner Form von Leistung zu tun hat, zeigt sich daran, dass auf jede kritische Anfrage an den Exklusivismus die stereotype Antwort kommt, andernfalls sei ja erstens alle Mission für die Katz und zweitens gehe die Moral den Bach runter, weil sich niemand mehr anstrengen würde. Das tatsächliche Vorhandensein der jenseitigen „Hölle“ wird so zum objektiven wie subjektiven Grund christlicher Mission. Objektiv, weil der doppelte Ausgang des göttlichen Gerichts schon jetzt fest steht, und subjektiv, weil nur der, der die Dringlichkeit der katastrophalen Lage der Anderen verinnerlicht hat, alle Kräfte dafür aufbieten wird, die Sünder umzustimmen. Alles andere liefe in dieser theologischen Konstruktion auf unterlassene Hilfeleistung hinaus, die selbst wieder zum Ausschluss führen müsste. Den ersten Christen scheint das eher fremd gewesen zu sein.
Reichlich unklar bleibt freilich, wie jemand, der das ernsthaft glaubt (nur um nicht missverstanden zu werden: die allermeisten Exklusivsten sind sehr nette und zum größeren Teil auch kluge Menschen!), überhaupt noch ruhig schlafen kann, denn alle Mühen sind augenscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und jede Nacht könnte theoretisch jemand sterben, dem ich das Evangelium schuldig geblieben bin. Verständlich also, wenn man versucht sein sollte, um des vermeintlich guten Zwecks willen auch mal zu fragwürdigen oder recht drastischen Mitteln zu greifen. Zumindest ergibt sich das Problem, anderen permanent ihre echten oder vermuteten moralischen Defizite vorhalten zu müssen, derentwegen ihnen die gerechte Verbannung in die äußerste Finsternis droht (ein passabler Ausweg aus dem Dilemma wäre die Lehre von der doppelten Prädestination, denn die erlaubt es, fröhlich an der eigenen exklusiven Erwählung festzuhalten ohne sich über den gottgewollten Verlust der vielen anderen zu grämen und das alles noch als Akt vollkommener Gnade zu feiern). Vielleicht sollte man das theologisch zutreffender als „Teilversöhnung“ bezeichnen. Donald Miller kommentierte treffend: “If the religious fundamentalists are right, heaven will be hell. And almost nobody will be there.”
Exklusivsten nämlich bezeichnen den Widerspruch gegenüber ihrer Position mit dem Kampfbegriff „Allversöhnung“. Nicht nur jene, die richtig glauben, werden nach dieser Vorstellung erlöst, sondern alle Menschen. Jesus ist nicht nur für wenige Erwählte gestorben, sondern für die von Gott geliebte Welt und Menschheit. Während Exklusivisten vielfach Himmel und Hölle zum Glaubens- und Bekenntnisgegenstand erheben und ausgiebig zum Thema christlicher Doktrin machen, die ihrerseits vornehmlich Gewissheiten begründen soll, liegt bei vielen der „Allversöhnung“ beschuldigten Theologen die Sache ein bisschen anders. Hans Urs von Balthasar hat in seinem „Kleinen Diskurs über die Hölle“ unter anderem zwei Dinge herausgestellt: Christen sind zum Festhalten an der Hoffnung gerufen, dass Gottes Heil am Ende alle Menschen erreicht, und zugleich müssen sie die Warnungen der Bibel, dass dieses Heil kein bloßer Automatismus der Weltgeschichte ist, und man Gottes Ziel für das eigene Leben verfehlen kann, für sich persönlich ganz ernst nehmen. Diese Mahnungen wirken einer gnadenlosen Selbstgefälligkeit entgegen, während jene Hoffnung für die anderen den Horizont der Gnade ganz weit offen hält.
Denn eine „Allversöhnung“, die lediglich darin bestünde, dass Gott aus einer müden Laissez-faire-Nettigkeit heraus alles ignoriert, was Menschen einander und ihren Mitgeschöpfen antun, die das Problem des Leidens und menschlicher Bosheit nicht ernst nähme (und damit auch die Opfer derselben), wäre auch keine gute Nachricht für die Welt. In der Fortschrittseuphorie des 18. und 19. Jahrhunderts war es vielleicht noch denkbar, dass diese düsteren Seiten der Menschheit sich irgendwann erübrigen. Heute ist niemand mehr so naiv. Ebensowenig kann es ja um einen „Zwangshimmel für alle“ gehen, wie Steve Turner einmal spöttisch dichtete.
Einig waren sich jedoch, das hat jüngst Brian McLaren wieder betont, beide Richtungen bisher oft in der Annahme, dass es im Evangelium primär um die Frage der „Seelenrettung“ geht, wo und wie der einzelne Mensch die Ewigkeit verbringt, und dass das Leben hier und jetzt vor allem im Blick auf jene Zukunft zu sehen und zu bewerten ist. Nun könnte man sagen, im Zweifelsfall gehen wir vom ungünstigeren Fall aus und freuen uns, wenn Gott großzügiger ist, als wir denken. Mit dem gleichen Recht kann man aber auch umgekehrt argumentieren, das strenge Gottesbild der exklusivistischen Verkündigung sei so negativ, dass es viele Menschen abstößt und damit das Gegenteil dessen erreicht, wozu es theoretisch da ist.
Wenn es aber zutrifft, dass Jesus die kommende Herrschaft Gottes im Sinne der jüdischen Prophetie als Befreiung Israels und der Welt aus der inneren und äußeren Versklavung unter zerstörerische Mächte verstanden hat, wenn die Auferstehung das Urdatum der Neuschöpfung ist, wenn es weniger darum geht, Menschen „in den Himmel“ als den Himmel zu den Menschen zu bringen, wenn Jesu Gerichtsworte viel mehr von innergeschichtlichen als überzeitlichen Folgen destruktiven Verhaltens handeln, dann wird das Diesseitige nicht länger zugunsten des Jenseitigen abgewertet, das Soziale nicht mehr zugunsten des Individuellen, das Äußere, Politische nicht mehr zugunsten des Innerlichen und Religiösen. Der Bogen von der Schöpfung nur Neuschöpfung reicht an beiden Enden weiter als der von der Erbsünde zum Weltgericht. Dann verlangt das nach einer integralen Spiritualität aus Aktion und Kontemplation (oder, wie Paul Zulehner es nannte, Mystik und Politik), dann sind andere Weltanschauungen nicht in erster Linie Konkurrenz, die Menschen vom wahren Heilsweg ablenkt, sondern durchaus auch mögliche Partner in der Erwartung des Neuen. Dann muss ich an anderen Menschen nicht die Schatten und Schwächen finden und ans Licht zerren, sondern ich kann all das würdigen, was Gott schon Gutes geschaffen hat – und auf dieser Grundlage dann Probleme und Konflikte lösen.
Mission hieße dann, Menschen für diese Bewegung der Versöhnung und Umgestaltung zu mobilisieren, die ihnen vielleicht auf absehbare Zeit größere Unannehmlichkeiten bringt als vordergründigen Gewinn, weil die Saat des Guten langsam und ungleichmäßig verteilt heranreift und alles auf eine Zukunft hin angelegt ist, für die wir keine andere Garantie haben als die biblische Verheißung. Es hieße, diesen Himmel der Gegenwart Gottes im Gewöhnlichen und Unvollkommenen (das „Heil-Land“) auch jenen offen zu halten, die ihn missverstehen, verachten oder gar vernichten wollen. Es hieße aber auch, die vielen Höllen auf Erden zu bekämpfen und in Gottes Namen ihren Protagonisten und Nutznießern hartnäckig zu widerstehen. Die Kraft dazu werden Menschen nur schwerlich finden, wenn sie nicht bei Gott „eintauchen“ und aus der Hoffnung und Kraft der Auferstehung schöpfen. Jürgen Moltmann hat die Alternative schön auf den Punkt gebracht:
Die Messiashoffnung kann in beiden Richtungen wirken: Sie kann das Herz der Menschen aus der Gegenwart abziehen und in die Zukunft setzen. Dann entleert die Messiashoffnung das gegenwärtige Leben, das Handeln, aber natürlich auch das Leiden an den gegenwärtigen Unterdrückungen. Sie kann aber auch die Zukunft des Messias vergegenwärtigen und die Gegenwart mit dem Trost und dem Glück des nahenden Gottes erfüllen. Dann erzwingt die messianische Idee gerade kein »Leben im Aufschub«, sondern ein Leben in der Vorwegnahme, in welchem alles schon in endgültiger Weise getan werden muss, weil das Reich Gottes auf die Weise des Messias schon »naheherbeigekommen« ist. (Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen. S. 43)


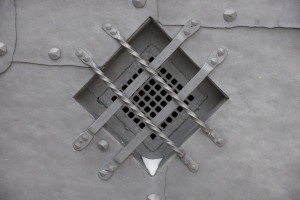
 Etliche waren da, viele haben etwas versäumt und manche haben inzwischen schon nach den Mitschnitten gefragt: Am Wochenende hatten wir
Etliche waren da, viele haben etwas versäumt und manche haben inzwischen schon nach den Mitschnitten gefragt: Am Wochenende hatten wir 
