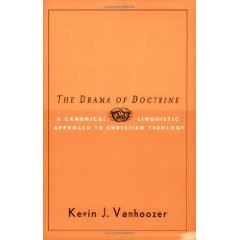Es gibt nicht so viele Ereignisse, zumal Gottesdienste, die auch nach dreißig Jahren noch nachwirken. Für mich war der Abend des 29. Dezember 79 so ein heiliger Moment. Ein Etappe auf meinem persönlichen Weg wurde abgeschlossen und ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich war ein gutes halbes Jahr festgesteckt an einer für mich wichtigen Frage: Wie – wenn überhaupt – kann ich Gott lieben?
Jesus nennt die Liebe zu Gott das höchste Gebot, zusammen mit der nicht minder unmöglichen Liebe zum Nächsten, also dem, den man sich in der Regel gerade nicht aussuchen konnte, und der daher um so mehr zum Intimfeind zu werden droht, je näher er uns ist. Dass Gott mehr als an allem anderen an meiner Liebe interessiert ist, schien mir völlig plausibel.
Doch die Liebe zu Gott lässt sich nicht fabrizieren. Man kann sie wohl vortäuschen, man kann ein bestimmtes äußeres Verhalten imitieren, aber man kann sich selbst nicht belügen. Je mehr ich mich anstrengte, desto weiter schien ich mich von Ziel zu entfernen. Um nicht falsch verstanden zu werden: Klar ist menschliche Liebe, auch Liebe zu Gott, immer schwach und (was mich betrifft zumindest, und im Rückblick auf 30 Jahre) sehr schwankend. Und doch merkt man, ob sie da ist. Ich nahm Gott und mich selbst ernst genug, um mir einzugestehen, dass es ohne diese Liebe nicht geht. Ich kann alles haben, schreibt Paulus, aber ohne Liebe ist es nichts.
Ich habe mir diesen Mangel nicht schön geredet und auch niemand anders tat es für mich. Es wusste ohnehin keiner davon. Ich kannte Menschen, die konnten Gott lieben. Sie sagten das, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass das authentisch war. Mir aber gelang das einfach nicht, und ich konnte mir nichts in die Tasche lügen.
An diesem Tag hatte mich jemand eingeladen, eine ganz simple geistliche Übung zu machen. Anhand einer kleinen Meditation zu den zehn Geboten sollte ich mein Leben auf unbereinigte Dinge und Beziehungen überprüfen. Es kam einiges zusammen, alles keine großen Verbrechen, aber immerhin ein kleines Panoptikum von Haltungen, kleinen Gewohnheiten und Gedanken, angesichts derer mir – bei Licht betrachtet – schon immer unwohl gewesen war. Es tat gut, festzustellen: Ja, das alles ist vorhanden in mir, aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann will ich es nicht mehr haben.
Diese Dinge dann im Beisein eines Seelsorgers auszusprechen und beim Namen zu nennen kostete zwar etwas Überwindung, war aber dann doch eine erstaunlich nüchterne Sache. Das Gespräch endete mit einem kurzen Gebet und einer Formel, mit dem mir die Vergebung zugesprochen wurde. Die Wirkung war unerhört. Als ich später in den Gottesdienst kam, betrat ich heiligen Boden. Und ich war nicht der einzige. Heute habe ich den Pfarrer besucht, der diesen Gottesdienst damals mit uns gefeiert hat. Und zu meiner Überraschung erzählte er, dass er das ganz ähnlich erlebt hat: dicht, intensiv, voller Staunen, eine fast greifbare Gegenwart. Irgendwo tief drinnen sprudelte die Liebe zu Gott hervor, als hätte der alte Mose mit seinem Stab auf den Felsen meines Herzens geschlagen. Und sie wollte gar nicht mehr aufhören – zum Glück.
Man kann Gänsehautgottesdienste nicht machen. Sie sind selten. Eines aber kann man: Da sein. Wer nicht kommt, erlebt garantiert nichts.